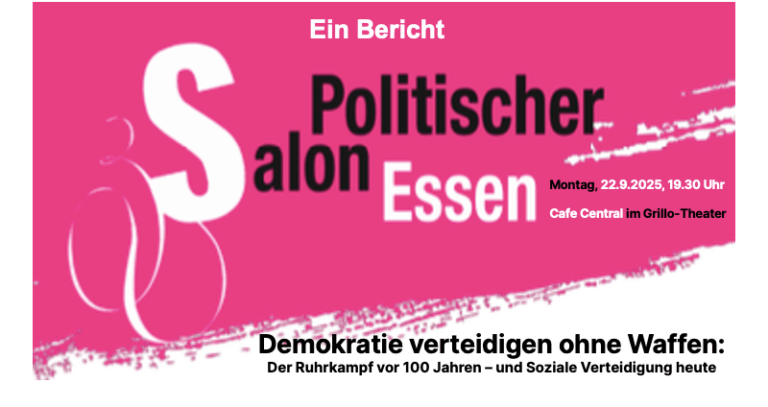Von Stephan Brües
Essen ist prädestiniert für eine Veranstaltung mit dem Titel „Demokratie verteidigen ohne Waffen: Der Ruhrkampf vor 100 Jahren – und Soziale Verteidigung heute“.
Denn zum einen war der damalige Oberbürgermeister Hans Luther ein persönliches Bindeglied zwischen der Stadt Essen und der Reichsregierung in Berlin, der er als Ernährungsminister, Finanzminister und zuletzt als Reichskanzler angehörte. Zum andern unterstützen der gegenwärtige Oberbürgermeister Thomas Kufen und der für Sicherheit der Stadt zuständige Beigeordnete Christian Kromberg die Wehrhaft ohne Waffen – Modellregion Essen darin, Soziale Verteidigung bekannt zu machen.
Oberbürgermeister Luther zeigte in seinem Verhalten Haltung gegen die in seinen Augen illegale Besetzung: Er kam nicht vor das Rathaus, um die Herrschaft der Stadt zu übergeben. Stattdessen mussten die Offiziere warten und wurden dann – wie jeder andere auch – im Dienstzimmer empfangen. Hier erhob der Oberbürgermeister Einspruch gegen die Gewalt. (s. https://gewaltfreieaktion.de/vom-ruhrkampf-lernen-demokratie-verteidigen-durch-guetekraeftiges-handeln/).
Das Plenum im Politischen Salon
Mit dem Ruhrkampf auf unterschiedliche Weise eng verbunden waren drei der vier Podiumsteilnehmer*innen:
Pfarrer Thomas Mämecke aus Datteln nahm teilweise die Sicht der Besatzerseite ein, als er Étienne Bach vorstellte. Dieser war dort 1923 als Offizier Teil der französischen Besatzungsmacht und musste sich zum passiven Widerstand der Verwaltung und der Bevölkerung verhalten. Dem nicht kooperierenden örtlichen Verwaltungschef, Karl Wille, drohte er Verhaftung an.
Als der Franzose jedoch am Karfreitag 1923 im evangelischen Gottesdienst in Datteln neben ihm am Abendmahl teilgenommen hatte, gab er ihm die Hand. „Feinde wurden zu Gegnern“, sagte Bach später, Respekt sollte allen zuteil werden, Karl Wille wurde nicht festgenommen. Zurück in Frankreich, gründete der Elsässer den Christlichen Friedensdienst. Beginnend mit Jugendaustausch zwischen Frankreich und Deutschland, leistet dieser bis heute in vielen Ländern vielerlei Friedensarbeit.
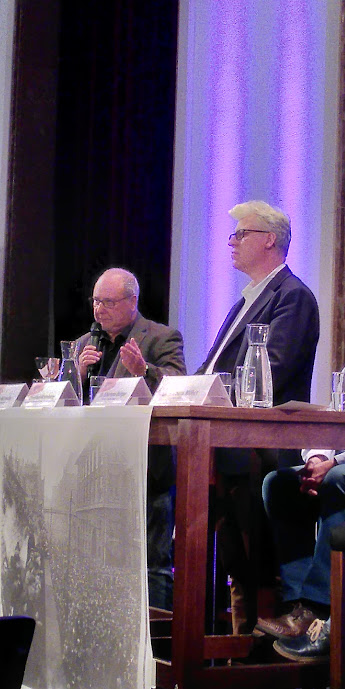
Eine Familiengeschichte verbindet den Beigeordneten der Stadt Essen für Recht, Sicherheit und Ordnung Christian Kromberg mit der Zeit des Ruhrkampfs und dem Übergang zur nationalsozialistischen Herrschaft. Krombergs Vater erforschte als Historiker das Wahlverhalten in Essen zwischen 1920 und 1925. Bereits in dieser Zeit sei eine Radikalisierung der politischen Parteien sichtbar gewesen – hin zur KPD und der DNVP, einer völkisch-nationalen Partei. Krombergs Urgroßvater, ein Pfarrer, stand dieser rechtsgerichteten Partei nahe. Und zur Machtergreifung von Adolf Hitler am 30.01.1933 verglich dieser in einer Predigt Hitler mit Jesus.
Was ist der Ansatzpunkt für Herrn Kromberg, der 1986/87 den Wehrdienst leistete, sich offen zu zeigen für Soziale Verteidigung?
Als Zuständiger für Zivil- und Katastrophenschutz muss er im Kriegsfall den Schutz der Bevölkerung organisieren. Aktuell sieht er Deutschland einer hybriden Kriegsführungsstrategie von Russland, China und dem Iran ausgesetzt, deren Ziel es sei, Europa durch Sabotage, Desinformation und Cyberattacken zu destabiliieren; von letzterer sei auch seine Stadtverwaltung bereits betroffen gewesen. Zivile Verteidigung und der Aufbau einer resilienten Gesellschaft seien unbedingt notwendig. Alle müssten überlegen, wie sie unsere demokratischen Werte schützen könnten. Hier sehe er Schnittmengen mit dem Anliegen der Sozialen Verteidigung, die Essener Gruppe von “Wehrhaft ohne Waffen” könne mit diesbezüglicher Expertise ein Verbündeter sein.

Dr. Barbara Müller promovierte vor 30 Jahren mit der Studie „Passiver Widerstand im Ruhrkampf. Eine Fallstudie zur gewaltlosen zwischenstaatlichen Konfliktaustragung und ihren Erfolgsbedingungen“ und hat 2025 ein neues Buch unter dem Titel „Kämpferische Demokratie“ (LINK: https://gewaltfreieaktion.de/vorveroeffentlichung-kaempferische-demokratie/] geschrieben, in dem sie auch den (Verhandlungs-)Weg bis zum Abzug der französischen und belgischen Truppen aus dem Ruhrgebiet 1925 nachzeichnet.
Die Moderatorin des Politischen Salons, Ursula Garczarek, stellte ihr vier Fragen, die Barbara Müller wie folgt beantwortete:
1.) Warum fand die Ruhrbesetzung statt?
Frankreich und Belgien waren besonders stark von den Folgen des 1. Weltkriegs betroffen. Die Bevölkerung dort und auf deren Druck die Politiker*innen verlangten Vergeltung von den Deutschen, die sie als Hauptschuldige ausgemacht hatten. Das Deutsche Reich sah die Schuldfrage anders und empfand die Bestimmungen zu Reparationen aus dem Versailler Vertrag als unangemessen. Zugleich aber hatte es keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Als Reparationen nicht in der geforderten Höhe geleistet wurden, nahmen Frankreich und Belgien das Ruhrgebiet mit der Besetzung als Faustpfand ein.
2.) Welches waren die treibenden Kräfte des Widerstands?
Der Widerstand hatte Akteure, aber der Anstoß kam doch von der Regierung unter Reichskanzler Cuno, die die Besatzung nicht akzeptieren wollte und – mangels militärischer Alternativen – zum damals sog. „passiven Widerstand“, d.h. zur Nicht-Zusammenarbeit mit den Besatzern aufrief. Arbeiter*innen (Eisenbahn, Bergbau) und Gewerkschaften beteiligten sich ebenso wie die Ruhrbarone, diese retteten die Unterlagen über die Kohleproduktion vor dem Zugriff der Besatzungsmächte nach Münster. Auch die Kommunalverwaltungen waren aktiv beteiligt, mit dem Essener OB Luther und seiner Losung „Wir machen nicht mit“ als wichtigem Impuls.
3.) Welche Methoden wurden angewendet?
Die Methoden des Ruhrkampfs waren vielfältig: von Demonstrationen, dem Verkaufsboykott an Besatzungssoldaten bis zu Zechenbesetzungen. Bei einer dieser Zechenbesetzung kam es zum Blutsamstag mit 13 toten Zivilist*innen. Das führte zu einer großen Wut in der Bevölkerung. Auch wenn es militante Formen des Widerstands gab, war doch insgesamt gesehen die Disziplin für gewaltfreies Handeln vorhanden.
Ergänzend die Antwort auf eine spätere Frage aus dem Publikum: Repressionen der Besatzer (Verhaftungen, Ausweisungen, der Blutsamstag) waren vergleichsweise moderat, wurden bei gewaltsamen Formen des Widerstands jedoch härter.
4.) Welche Lehren sind aus diesen Erfahrungen für heute zu ziehen?
Die wichtigste Lehre für heute:
Der Widerstand gegen den Aggressor von außen als gemeinsamen Feind hat über die Gräben einer sehr polarisierten Gesellschaft (Gewerkschaften – Konzerne, Kommunisten – Völkisch-Nationale usw.) zusammengefunden. Dazu gab es sozialen Druck, die Besatzer als Feinde abzulehnen.
Mahatma Gandhi, Dr. Martin Luther King oder Hildegard Goss-Mayr dagegen entwickelten Formen gewaltfreier Konfrontation, die auf dem Gespräch mit dem Gegenüber beruhten – praktiziert 1968 in der Tschecheslowakei oder 1986 auf den Philippinen, als Bürger*innen mit den Soldaten in den Panzern redeten, um sie von ihrem repressiven Tun abzubringen.
DDR 1989: Gewaltfreier Widerstand unter repressiven Bedingungen
Eine andere Form des gewaltfreien Widerstands repräsentierte auf dem Podium Eberhard Bürger, der viele Jahren in Magdeburg als Pfarrer tätig war und bis heute für den Frieden u.a. im Versöhnungsbund aktiv ist. Er war an der Protestkundgebung am 2. Oktober 1989 im Magdeburger Dom beteiligt. Dort trafen sich 1.300 Menschen und erarbeiteten in 26 Arbeitsgruppen Forderungen an die SED-Regierung: Presse- und Meinungsfreiheit, Parteienvielfalt, ein ziviler Ersatzdienst für Kriegsdienstverweigerer und vieles mehr. Was die Menschen, die gewaltfrei das SED-Regime zu Fall brachten, allerdings nach der Wiedervereinigung erhielten, war eine “marktkonforme Demokratie”, die viele Errungenschaften aus der kurzen Wendezeit (Runde Tische usw.) ad acta legte.
Bürger wirkte bereits seit den 1980er Jahren an den friedenspolitischen Aktivitäten der Evangelischen Kirche der DDR mit. Dazu gehörten der Einsatz für Kriegsdienstverweigerer, für Friedenserziehung, darüber hinaus die Ablehnung von militärischer Abschreckung und Atomwaffen sowie das Eintreten für Gemeinsame Sicherheit für alle beidseits der Grenze zwischen den Blöcken. Nach dem Ende der DDR hat die bundesweite Evangelische Kirche in Deutschland diese pazifistischen Positionen 1991 verworfen.
Die Impulse der DDR-Umwelt-, Frauen-, Friedens- und Menschenrechtsbewegung wirkten international weiter bis in die UN-Milleniumsziele hinein, die eine gute Orientierung für eine bessere Welt sind.
Fragen aus dem Publikum
Aus dem Publikum von rund 80 Personen kamen Fragen zur Vergangenheit (Ruhrkampf) und der Gegenwart (gegenwärtige politische Situation, inkl. Militarisierung).
In Bezug auf den Ruhrkampf wurde die wichtige Frage gestellt, wie es denn zu dem Ende der Besatzung 1925 gekommen sei. Die Antwort: Man hat den diplomatischen Weg beschritten und dabei haben die deutsche Reichsregierung wie auch die anderen Regierungen ihre destruktiven Positionen verlassen und es wurde ein Faden des gegenseitigen Verständnisses gesponnen.
So ging es peu à peu voran: Ein wichtiger Schritt war, dass neue Reparationsregeln verabschiedet wurden, die ausdrücklich militär-gestützte Sanktionen (z.B. eben eine Besatzung) untersagten. Die Bestimmung galt zwar nicht rückwirkend, aber sie höhlte die Legitimität der Besatzung aus, sodass innerhalb eines Jahres das Ruhrgebiet, beginnend mit Dortmund, vollständig von Besatzungstruppen geräumt werden konnte. Und dieser Abzug geschah in Sorge um die Gesichtswahrung der Abziehenden: Keine Feier, bevor nicht alle Soldaten das Ruhrgebiet verlassen haben.
Fragen zur gegenwärtigen Situation bezogen sich auf die Dialogfähigkeit – allgemein zwischen Menschen mit verschiedenen Meinungen, aber auch konkret in Bezug auf Putin. Diesem bescheinigten Kromberg und Mämecke einen Unwillen zum Dialog.
Aber – so fragte etwa der Essener Friedensaktivist Bernhard Trautvetter – betrieben nicht auch NATO-Staaten Desinformation und bereiteten sie nicht auch – z.B. wieder am 30.09.2025 auf einer Strategiekonferenz in der Essener Gruga-Halle – kriegerische Handlungen vor?
Müssten wir also nicht – ähnlich wie bei der gewaltfreien Revolution gegen die SED-Regierung 1989 – Regierungen, die vorrangig auf militärische Stärke setzten, Widerstand entgegensetzen, um Frieden zu wahren? fragte eine Frau. Der Krieg müsse aus den Köpfen entfernt und Frieden eingepflanzt werden.
Das Podium war sich in manchen Punkten sicher uneinig, aber was sie doch vereinte, war der Gedanke, dass wir von einem Win-Loose-Denken (einer gewinnt, der andere verliert) zu einem Win-Win-Denken (beide gewinnen) kommen müssen, wie ein Teilnehmer anmahnte. Genannt wurde eine Initiative, die in Halle an der Saale Dialogräume für Menschen schafft, die höchst unterschiedliche Positionen zu bestimmten Fragen hatten oder haben.
So beendete die Moderatorin Ursula Gaczarek den Abend mit dem Satz „Wir reden mit allen!“
Fazit
Im Untertitel des Politischen Salons wurde angedeutet, dass die Erfahrungen aus dem Ruhrkampf in die Frage einfließen sollten, wie Soziale Verteidigung unter den heutigen Bedingungen umgesetzt werden könnten.
Sowohl durch die Besetzung des Podiums als auch bezüglich der Fragen aus dem Publikum war der Rückblick auf den Ruhrkampf sehr viel stärker präsent als die Fragen des Heute. Das heißt nicht, dass die Verbindung zur Frage, wie wir die Demokratie gegen außen oder auch innen verteidigen sollten, gar nicht hergestellt wurde.
Dass ein nationalistisches Feindbild die unterschiedlichen Akteur*innen im Ruhrkampf zum gemeinsamen Widerstehen zusammenschweißte, ist ja durchaus problematisch. Wer 2023 die Ausstellung im Essener Ruhrmuseum zum Ruhrkampf gesehen hat, erinnert sich an die dort gezeigten Kariktaturen, die seinerzeit kursierten, gefüllt mit blankem Rassismus gegen die Franzosen.
Umso wichtiger waren in diesem Zusammenhang zwei Punkte: Erstens der tätige Impuls von Étienne Bach, aus Feinden im ersten Schritt Gegner und später Freunde zu machen, der damit dem stereotypen nationalistisch-rassistischen Blick klug und kreativ einen entschiedenen Willen zum Frieden entgegensetzte – der bis heute weiterwirkt. Dabei geht es um die Haltung zu einem Gegenüber im Konfikt.
Zweitens, dass der Dialog mit den anderen am Konflikt Beteiligten den zivilen, gewaltfreien Widerstand stark macht: der Dialog, der auch bei konfrontativen Aktionen mit den Ausführenden der Repression oder der illegitimen Macht geführt wird, um die Repression zu beenden. Das hätte auch Eberhard Bürger über die Aktivitäten der gewaltfreien Revolutionäre in der DDR sagen, wenn er danach gefragt worden wäre.
Hier geht es um die vorbereitete Umsetzung der Haltung zum Gegenüber im Konflikt.
Beide Aspekte sind wichtige Säulen auch der Konzeption von Sozialer Verteidigung, wie sie die Kampagne “Wehrhaft ohne Waffen” vertritt (LINK: https://wissenschaft-und-frieden.de/dossier/soziale-verteidigung-aufbauen/).
Beide Aspekte sind wichtig für den Erfolg sowohl im Ruhrkampf wie in der Ablösung des repressiven SED-Regimes. Um so wichtiger ist es, sehr viel öfter an diese Errungenschaften gewaltfreie Handelns zu erinnern – und daraus für die Gegenwart zu lernen.
Der Wille, heute in diesem Sinne zu handeln, war im Café Central in Essen zu spüren.
Die Offenheit der Stadt Essen für die Idee der Sozialen Verteidigung, personifiziert sowohl durch den Oberbürgermeister Thomas Kufen, der am Abend zuvor Laudator bei der Verleihung des Gütekraft-Preises durch die KräftigeGüte-Stiftung war (siehe dazu: https://www.xn--krftigegtestiftung-mtb00c.de/tag-der-guetekraft), als auch durch den Beigeordneten Christian Kromberg an diesem Abend, sind gute Voraussetzungen und Anknüpfungspunkte, um Soziale Verteidigung voranzubringen – in Essen und darüber hinaus.
Zum Autor
Stephan Brües ist Redakteur von gewaltfreieaktion.de, Mitglied der Steuerungsgruppe von Wehrhaft ohne Waffen und Ko-Vorsitzender des Bund für Soziale Verteidigung.