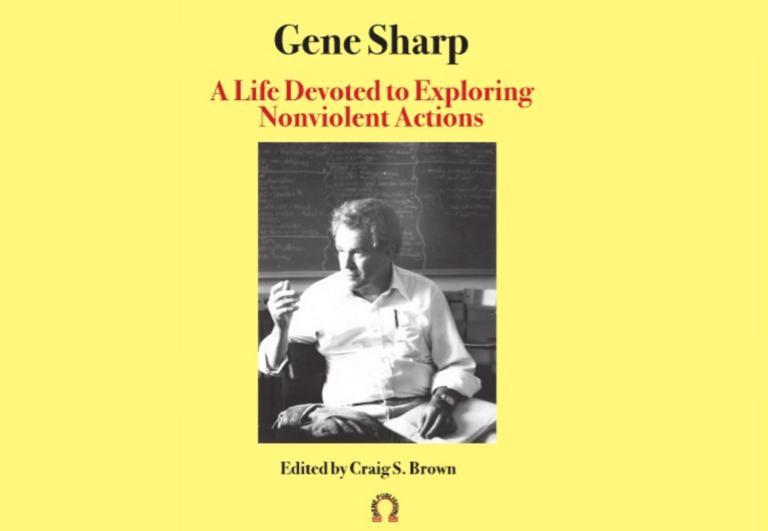von Martin Arnold
Der Band richtet sich an Menschen in sozialen Bewegungen sowie an Forschende und setzt kaum Vorkenntnisse voraus. Leser*innen, die bereits mit Sharps Werk vertraut sind, werden durch viele kaum bekannte Details bereichert.
Das Buch enthält sowohl wissenschaftliche Beiträge, nach Sharps Arbeits- und Wirkungsgeschichte geordnet, als auch ein Interview mit den skandinavischen Friedensforschern Jørgen Johansen und Stellan Vinthagen sowie zentrale Texte von Sharp selbst und eine Publikationsliste.
Sharp sah zunächst Gandhis Erfolge in „moral power“, der Kraft moralisch guten Handelns, begründet. Er entdeckte dann, dass die Massen, die Gandhi folgten, nicht immer den ethischen Standards entsprachen, die dieser forderte. Daraufhin definierte Sharp „gewaltfreie Aktion“ als eine „Technik“, die mit Moral nichts zu tun habe. 1973 beschrieb er 198 Methoden von Protest über Nichtzusammenarbeit (Boykott usw.) bis hin zu Interventionen (z.B. Parallelregierungen) und meinte, mit diesen Methoden können Volksmassen beliebige politische Ziele ohne direkte Gewalt durchsetzen. Sein Buch „From Dictatorship to Democracy“ (1993) wurde in mehr als 30 Sprachen übersetzt und hat in vielen Ländern gewaltfreie Revolutionen beeinflusst. Gandhis Gewaltfreiheit bezeichnete er als ethisch, prinzipiell oder religiös, die eigene als pragmatisch oder strategisch.
„Prinzipielle und pragmatische Gewaltfreiheit verschmelzen“
Brian Martin schreibt einen Beitrag über „Gene Sharps politisches Denken“ („The Politics of Gene Sharp“). Der Australier stellt die „wechselnde Rolle der Gewaltfreien Aktion und Theorie“ dar, beginnend mit dem Einfluss Gandhis. Dessen Ansatz sieht er als basierend „auf dem moralischen Prinzip, Gewaltanwendung gegen Gegner abzulehnen“. Davon unterscheide sich letztlich Sharp in seinen Veröffentlichungen durch die Argumentation: „Gewaltfreie Aktion soll deshalb angewendet werden, weil sie effektiver ist als Gewalt“.
Dazu ist anzumerken, dass auch nach Gandhis Überzeugung seine Streitkunst „satyagraha“ der Gewalt überlegen ist: Er hielt die „Kraft, die aus Wahrheit und Liebe entsteht“ [1] für „unendlich viel größer als die Kraft von Waffen“ [2].
Brian Martin resümiert in seinem Beitrag, dass Sharp dazu beigetragen hat, gewaltfreie Methoden als Werkzeuge zu sehen, die wirksamer sind als Gewalt. „[… Wir sollten] seine Studien und Ideen als Werkzeuge nutzen und anwenden, überarbeiten, verfeinern und darauf aufbauen.“ (S.82f, Übersetzungen M.A.)
Der Band enthält wichtige Bausteine für deren Weiterentwicklung:
„Prinzipielle und pragmatische Gewaltfreiheit sind nicht nur vereinbar, sondern sie verschmelzen sogar“, stellt Craig S. Brown fest und auch, dass Sharp die Trennung schon 1979 als „überbewertet“ ansah, „da er sah, dass die Dynamik beider sich gegenseitig verstärkt…“ Brown kritisiert den „extrem pragmatisch-strategischen und zwar quantitativen Forschungsansatz“ der aktuellen Friedensforschung und fordert, mit Vorrang Wege über diesen Ansatz hinaus zu finden. [3] (S. 158)
Brian Martin stellt fest, dass Sharp sich stark mit dem gewaltfreien Umgang mit autoritären Systemen beschäftigt hat. Er kritisiert, dass der US-Amerikaner keine Strategie zur Umgestaltung des militärisch-industriellen Komplexes der USA entwickelte (S.77).
Wichtig: „Positives Handeln“
Michael Randle, ein früher Weggefährte von Sharp, hebt hervor, dass für diesen „positives Handeln“ (positive action) wichtig war: Menschen müssen sehen, dass Worte in Taten umgesetzt werden können. Und auch selbst entsprechend tätig werden.
Andrew Rigby zeichnet Sharps Weg als Redakteur der „Peace News“ seit 1955 nach. Sharp plädierte für gemeinschaftliches Handeln über persönliche Kriegsdienstverweigerung hinaus, um Krieg zu verhindern.
Sharps Untersuchung des Widerstands von Lehrer*innen im Zweiten Weltkrieg in Norwegen ist im Buch abgedruckt.
Christine Schweitzer behandelt die Konzeptentwicklung der Sozialen Verteidigung (SV) seit 1910 sowie Erfolgsfaktoren zivilen Widerstands und SV in der Ukraine. Sie fragt nach den Lehren aus diesen Erfahrungen und betont die Notwendigkeit des Dialogs mit Gegner*innen – ein Aspekt, der in Sharps Schriften kaum eine Rolle spiele. Sie schreibt, dass SV in ein umfassendes Friedenskonzept eingebettet sein müsse.
Craig S. Brown setzt sich mit Vorwürfen gegen Sharp auseinander, er sei ein Verteidigungsintellektueller des Kalten Krieges oder habe neoliberale Politik unterstützt. Brown widerlegt sie überzeugend, indem er die jeweiligen Kontexte von Sharps Aussagen darlegt – wichtig in der Diskussion um Sharps Erbe.
Insgesamt leistet das Buch einen wertvollen Beitrag dazu, Sharps Lebenswerk zu würdigen und die Gewaltfreie Aktion in Theorie und Praxis besser zu verstehen und weiterzuentwickeln. Es ist besonders empfehlenswert für alle, die an Sharps Ideen oder den Grundlagen gewaltfreien Handelns interessiert sind.
[1] Mit diesen Worten erklärt er „satyagraha“: Collected Works of Mahatma Gandhi, digital, Vol. 34, S. 93
[2] a.a.O. Vol. 10, S. 289
[3] Der Rezensent hat einen qualitativen Forschungsansatz realisiert.
Craig S. Brown (Hg.) (2024): Gene Sharp – A Life Devoted to Exploring Nonviolent Actions. Irene Publishing, 256 Seiten, ISBN 978-91-88061-70-6, 26 €.
Zum Autor
Der Friedensforscher Dr. Martin Arnold aus Essen hat an zahlreichen gewaltfreien Aktionen mitgewirkt. Er arbeitet im Institut für Friedensarbeit und Gewaltfreie Konfliktaustragung, in der Stiftung Kraft der Gewaltfreiheit, bei Wehrhaft ohne Waffen und weiteren Friedensorganisationen mit. Thema seiner Doktorarbeit ist die Wirkungsweise aktiver Gewaltfreiheit. Er hat zahlreiche Beiträge in wissenschaftlichen und anderen Zeitschriften veröffentlicht und ist Redakteur von gewaltfreieaktion.de.