Von Martin Arnold
Im Streit erreichen wir gemeinsame und dadurch stabile Lösungen, wenn wir den anderen Beteiligten mit Wohlwollen begegnen. Diese weltweit verbreitete Handlungsweise ist unter Freund*innen und in Familien alltäglich, in der Politik weniger. Sie hat in verschiedenen Kulturen verschiedene Namen bekommen, darunter:
„Würde anbieten“ – „Nicht-Gewalt“ – „Güte“ – „Gerechtigkeit“ – „Feindesliebe“ – „Geduld“ – „Gute Macht“ – „dauernde Festigkeit“ – „Macht des Volkes” – „ruhige Kraft“ – „verändernde Kraft“ – „Nichtwiderstehen“ – „ziviler Widerstand“ – „gewaltlose Gewalt“ – „Gewaltlosigkeit“ – „Gewaltfreiheit“ – „gewaltfreie Aktion“ – „aktive Gewaltfreiheit“ – „Festhalten an der Wahrheit“ – „Gütekraft“ – „Stärke zu lieben“ – „Kraft der Gewaltfreiheit – „Gütigkeit“ – „Kraft der Gerechtigkeit“ – „Geistig-sittliche Kampfbereitschaft“ – „Die Macht der Armen“ – „Kreative Macht der Spiritualität“ – „Die Macht der Mutigen“ – „Der Dritte Weg Jesu“ – „Die dritte Macht“ …
Ich finde positive Bezeichnungen angemessener als verneinende oder ein „Gegen“ enthaltende, weil diese Art der Interaktion gute Wirkungen zeitigt, je klarer eine wohlwollende Haltung zu den Mitmenschen dahintersteht. Ich sehe die folgenden neun Tipps dafür als hilfreich.
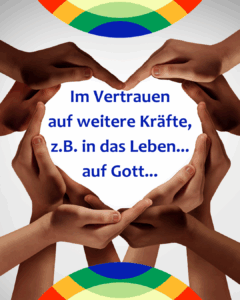
1) Vertrauen auf weitere Kräfte, z.B. auf das Leben …, auf Gott …
Aus dem Bewusstsein heraus, dass wir mit aktiver Gewaltfreiheit Gerechtigkeit nicht erzwingen können, aber viel dafür tun können, vertrauen wir darauf, dass durch dieses Würde-Anbieten auch andere Kräfte mitwirken, damit mehr Menschlichkeit, mehr Gerechtigkeit, mehr Frieden verwirklicht wird.

2) Mut zeigen, auch in Ängsten.
In Auseinandersetzungen, gerade wenn es um Gerechtigkeit geht, spielen oft Ängste eine Rolle. Aber Mut kann man auch in Ängsten haben. Ihn auch gegenüber den anderen Beteiligten zu zeigen, ist ein Geheimnis dafür, ernst genommen und wichtig genommen zu werden. Und das können wir auch üben.
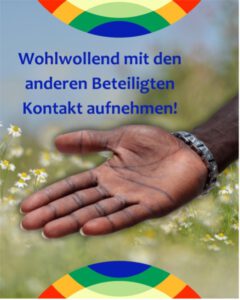
3) Wohlwollend mit den anderen Beteiligten Kontakt aufnehmen.
Das ist sehr wichtig, damit die gewaltfrei Aktiven, die sich für Gerechtigkeit und Frieden einsetzen, nicht nur ernst genommen werden, indem sie Mut zeigen, sondern auch geschätzt werden als Menschen, dass sie als Menschen erkennbar sind. Es bedeutet, dass wir auch in der Auseinandersetzung denen, die zunächst etwas anderes wollen, als Menschen anbieten, wohlwollend miteinander umzugehen. Das heißt: Unter allen Umständen mit Respekt und in Achtung ihrer Menschenrechte und Grundbedürfnisse und mit der Bereitschaft, sich mit ihnen zusammen für die Verbesserung der Verhältnisse auf beiden Seiten, auf allen Seiten einzusetzen.

4) Mit dem Missstand nicht durch Zuschauen oder Mitmachen zusammenarbeiten.
Oft ist es so, dass wir uns mit ungerechten Verhältnissen oder unfriedlichen Verhältnissen, ohne es zu wollen, bereits abgefunden haben.
Die Impulse zu gütekräftigem Vorgehen für mehr Gerechtigkeit und Menschlichkeit und Frieden werden an erster Stelle dadurch wichtig, dass ich mich frage: „Wo trage ich selber zu dem bei, was ich gar nicht möchte? Schaue ich zu und tue nichts? Oder mache ich sogar mit, ohne es wirklich zu wollen?
Es ist leider so, dass solches Mitmachen mit Ungerechtem in unserem Alltag unvermeidlich ist. Wir benutzen ein anderes Leben zum Essen und zum Trinken. Wir ernähren uns, indem wir töten. Ob es Pflanzen oder Tiere sind. Das ist nicht schön, das gehört aber zu unserem Leben dazu. In unserer zivilisierten Gesellschaft, wie wir das jetzt zivilisiert nennen, hochentwickelt, technisch, in der technischen Gesellschaft benutzen wir Computer, benutzen wir Handys und wissen doch, dass die Rohstoffe, die nötig sind, diese Geräte zu betreiben, oft unter schlimmen Bedingungen für diejenigen, die diese Rohstoffe aus der Erde bergen, verfügbar werden. Dass z. B. Coltan im Kongo unter Bürgerkriegsbedingungen gewonnen wird – ganz schlimm für die Beteiligten.
Es gibt viele Missstände, mit denen wir konfrontiert und in die wir auch involviert sind. Und wir müssen uns entscheiden, mit welchem Missstand wir uns so intensiv beschäftigen wollen, dass wir sagen: „Das wollen wir wirklich abbauen!“ Es gibt an vielen Stellen Möglichkeiten, das im Alltag im persönlichen Leben zu verwirklichen. Indem wir z. B. mehr Fahrrad als Auto fahren, beteiligen wir uns weniger am Missstand der fossilen Brennstoffe, deren Verbrennung das Klima schädigt. Aber wir können uns auch entscheiden, für einen bestimmten, besonders schlimm eingeschätzten Missstand gemeinsam aktiv zu werden. Und da ist die Entscheidung oftmals nötig, dass man nicht nur persönlich, sondern zusammen mit anderen sich fragt: „An welcher Stelle wollen wir bei uns selber anfangen, Missstände abzubauen?“

5) Bereit sein, entsprechende Kosten und Risiken auf sich zu nehmen.
Das gehört dazu, z. B. bestimmte Kosten des Fahrradfahrens statt Autofahrens sind, dass ich länger brauche, mit dem Fahrrad zum Ziel zu kommen. Allerdings hat es daneben auch eine sehr positive Wirkung, nämlich: Es ist gut für die Gesundheit. Aber Kosten und Risiken, wenn ich mich einem bestimmten Missstand in den Weg stelle, können auch sein, dass eine Aktivität durchaus unangenehm für mich ausgeht, dass z.B. bei einer Blockade die Polizei mich festnimmt, ich ins Gefängnis komme, dass ich also mit dem Risiko leben muss. Es ist gut, sich Risiken bei gewaltfreien Aktionen vorher klarzumachen und auch, wie dann mit diesem Risiko umzugehen ist.
Als Gandhi seine Satyagraha, seine Gütekraft-Aktion, propagierte, sagte er: „Wir haben es z. B. im Kampf zur Befreiung von der Kolonialmacht England mit Menschen zu tun, die bereit sind, für ihre Machterhaltung andere zu töten. Also müssen wir bereit sein, das Risiko auf uns zu nehmen, in diesem Einsatz zu sterben. Also es ist sehr unterschiedlich, was für Risiken das sein können und was für Kosten, die die Aktiven bereit sein müssen, auf sich zu nehmen, wenn wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Vor allen Dingen, wenn auf der anderen Seite mächtige Interessen etabliert sind.
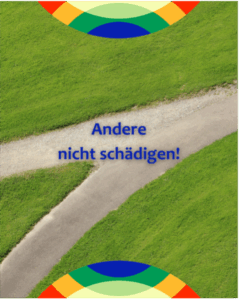
6) Andere nicht schädigen.
Dieses ist ja das Element, das in der traditionellen Benennung „Gewaltlosigkeit“ oder „Gewaltfreiheit“ genannt wird. Es ist ein sehr wesentlicher Punkt für die Kommunikation mit den anderen Beteiligten, die dafür gewonnen werden sollen, auch aufzuhören den Missstand zu unterstützen. Die Kommunikation würde gestört, wenn die anderen direkt geschädigt würden. Also ausgeschlossen ist direkte Gewalt, das heißt, Verletzung, Schädigung einer anderen Person. Das ist also Gewaltfreiheit, die sich beobachten lässt.
Es ist aber auch mehr gemeint: Nichtzusammenarbeit wie z.B. ein Boykott kann für die anderen Beteiligten zu erheblichen Nachteilen führen.
a) Durch einen Boykott oder andere Formen der Nichtzusammenarbeit können Betroffene bis zur Existenzgefährdung geschädigt werden. Wenn das droht oder gar die Absicht ist (wie in Deutschland 1933), ist der Bereich der Gewaltfreiheit verlassen, auch wenn keine direkte körperliche Gewalt ausgeübt wird. Denn ihre Menschenrechte und Grundbedürfnisse werden missachtet.
b) Gewaltfreie Nichtzusammenarbeit meint: Dem Missstand Unterstützung entziehen, um seine Ressourcen zu beschneiden. So soll der Missstand – nicht Personen – zu Fall kommen, Beispiel: Streiks für höhere Löhne, sie sollen nicht durch persönliche Schädigung zum Einlenken nötigen, sondern das niedrige Lohnniveau als ungerecht unübersehbar machen.
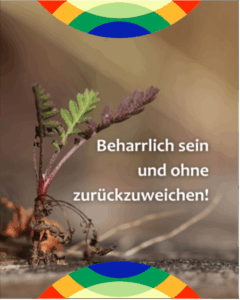
7) Beharrlich sein und ohne zurückzuweichen.
Dabei ist wichtig, sich durch Rückschläge nicht davon abbringen zu lassen. Also bevor wir eine gewaltfreie Aktion starten, ist es wichtig, sich darüber klar zu sein:
Wir müssen auch mit Rückschlägen rechnen. Wir müssen damit rechnen, dass je nachdem, um einen wie großen Missstand es sich handelt und wie der geartet ist, dass wir durchhalten müssen, dass unsere Durchhaltekraft strapaziert wird.
Und es ist sehr wichtig, nicht zurückzuweichen und dabei die Haltung aktiver Gewaltfreiheit aufrechtzuerhalten und nicht etwa dann zu Gewalt überzugehen, zur Schädigung anderer, wenn sich herausstellt, dass wir nicht auf Anhieb zum Ziel kommen.

8) Neue Ideen einbringen und möglichst konstruktiv handeln.
Damit ist gemeint, dass wir, wenn die anderen Beteiligten auf die Kommunikation, auf die gewaltfreie, gütekräftige Kommunikation, die von uns ausgeht, reagieren, dass wir nicht im Sinne von deren Interessen komplementär handeln. Also wenn Sie uns Dinge androhen, die uns verletzen oder die uns leiden lassen, dass wir dann erstens dieses Leiden nicht in dem Sinne akzeptieren, indem wir sagen: „Ja, jetzt sind wir leider in dieser Rolle, dass wir nachgeben müssen.“ Aber zweitens, wir nehmen dieses Leiden in Kauf und handeln, aber „nicht-komplementär“. Manchmal wird dabei auch von paradoxer Intervention gesprochen in dem Sinne, dass wir auf einer ganz anderen Ebene antworten als die Menschen, die auf unser Handeln durch z. B. Repression oder durch irgendwelche Arten von Unterdrückung oder Schaden-Zufügen auf uns reagieren.
Also z. B. habe ich gestern so ein Beispiel gehört. Ein Mann wurde provoziert von einem, der in der Auseinandersetzung mit ihm zur Gewalt greifen wollte und der sagte: „Nenn mich Arschloch, nenn mich Arschloch, nenn mich Arschloch!“ Dann sollte das die Provokation sein, die ihm erlauben würde, zuzuschlagen. Und die Antwort war: „Weißt du was? Ich habe meiner Mutter auf dem Sterbebett versprochen, niemanden Arschloch zu nennen.“ Das hat dazu geführt, dass der andere völlig perplex vom Provozieren abgelassen hat. Also nicht-komplementär antworten und dabei möglichst konstruktiv handeln.
Bei vielen Missständen ist es so, dass das Gegen weniger wirksam ist, als das Positive stattdessen aufzubauen, d.h. konstruktiv zu handeln. Gandhi hat es das konstruktive Programm genannt und Birgit Berg hat es mit dem schönen, aber etwas komplizierten Satz zusammengefasst: „Die überzeugendste Form des Nein zum Unzumutbaren ist das Ja zu den reiferen Möglichkeiten.“
Das ist das konstruktive Handeln. Und nicht nur die Möglichkeit erwähnen, sondern selber anfangen, das zu tun.
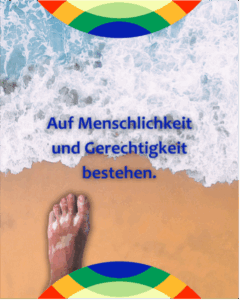
9) Auf Menschlichkeit und Gerechtigkeit bestehen.
Bei vielen gewaltfreien Aktionen ist das im Kleinen bereits in der Aktion enthalten, dann ist sie gut. Der Nestor der internationalen Friedensforschung, Johann Galtung, hat diese Art von gewaltfreien Aktionen als „zielenthüllende Aktionen“ bezeichnet. Und ein Beispiel ist etwa: Zurzeit der Apartheid in Südafrika waren die guten Strände für Weiße vorbehalten und die anderen Gruppen, die nicht zu den Weißen gehörten, die kriegten dann die weniger guten Strände, an denen sie sich zum Baden begeben sollten. Und da hat eine Gruppe schwarzer Frauen regelmäßig sonntags die „weißen Strände“ betreten und hat sich festnehmen lassen. Die Presse hat berichtet: Sie haben durch Ihre Aktion deutlich gemacht, die Gerechtigkeit, für die wir uns einsetzen, verwirklichen wir schon im Kleinen in unserer Aktion. Das ist zielenthüllend, das ist konstruktiv.
Wenn das gewaltfreie Vorgehen mit anderen Menschen zusammenhängt, die Ungerechtigkeit oder Unmenschliches aufrechterhalten wollen, dann ist es in der gesamten Anlage ganz wesentlich, darauf zu bestehen, dass mehr Gerechtigkeit und Frieden verwirklicht werden. Diese Entschlossenheit im Hintergrund: „Ich will mich, wir wollen uns mit Entschiedenheit einsetzen für mehr Menschlichkeit, für mehr Gerechtigkeit.“ Diese Entschlossenheit auch zur Stabilisierung der Gruppe, die aktiv wird und vielleicht zu leiden hat, immer wieder erneuern. Eine Vergewisserung dieser Entschlossenheit ist wichtig und hilft zur Beharrlichkeit, nicht zurückzuweichen. Hier kann der erste Punkt Bedeutungsvoll sein: das Vertrauen auf weitere Kräfte, auf das Leben, auf Gott. Diese Entschlossenheit können wir in diesem Vertrauen uns gegenseitig stärken und uns in dieser Entschlossenheit durch dieses Vertrauen auch gegenseitig stützen.
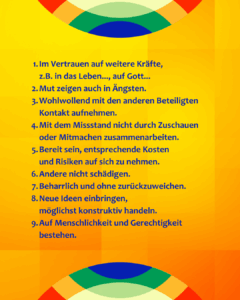
Die Politikwissenschaftler*innen Erica Chenoweth und Maria Stephan haben ermittelt, dass durch aktive Gewaltfreiheit regelmäßig stabilere Ergebnisse erzielt wurden als durch Waffengebrauch und dass ihre Erfolgsquote in Aufständen doppelt so hoch war. (siehe Jan Stehn im Dossier 101 „Soziale Verteidigung aufbauen“ von Wissenschaft & Frieden)
Ein Beispiel dieser starken Vorgehensweise aus Europa: Mit General- und Wehr-Streiks erlangte das einfache Volk, die Plebejer, in Rom vor mehr als 2.300 Jahren politische Gleichberechtigung (siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Secessio_plebis ).
Anmerkung
Nr. 1 wurde gegenüber einer früheren Version zur Vermeidung eines Missverständnisses ergänzt.
Zum Autor
Martin Arnold ist Mitglied der Redaktion von gewaltfreieaktion.de.

